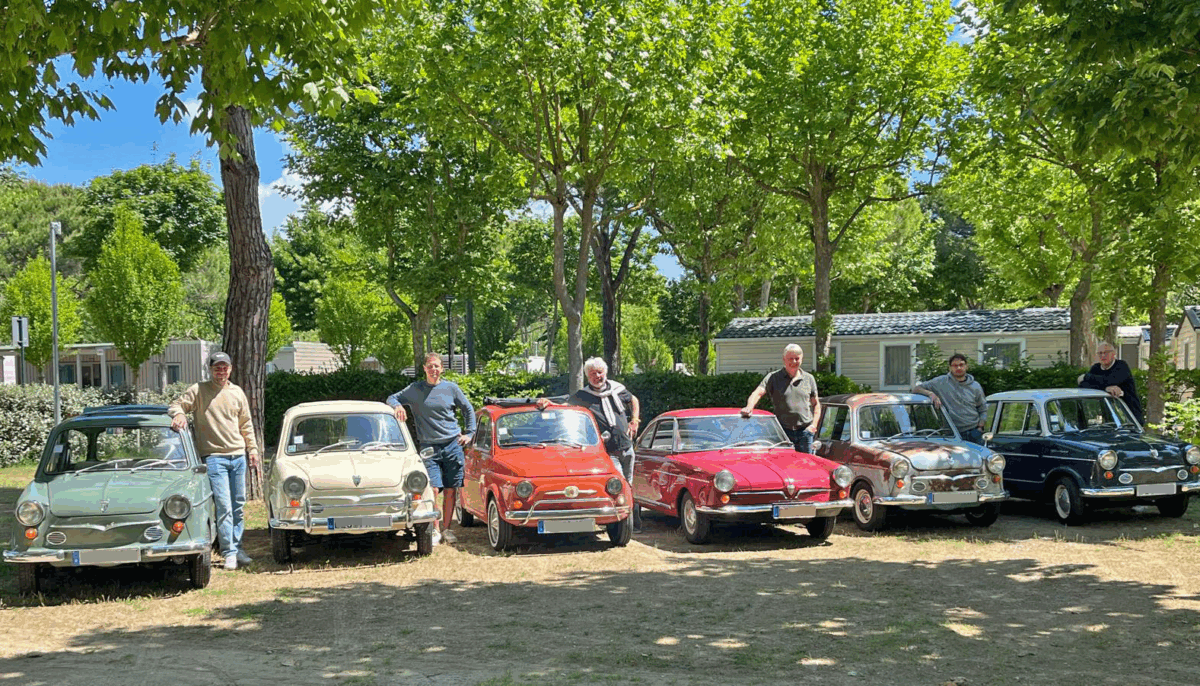- 19. Juni 2025
- Sicherheit & Praxis
- Michael Petersen
Für die Ferien muss der Kofferraum wachsen
Mehr Gepäck mitnehmen, aber mit mehr Sicherheit

Wirklich so viel Gepäck für die schönste Zeit des Jahres? Ja! Denn wenn der Urlaub vor der Tür steht, wird’s schnell eng im Kofferraum. Wir denken an das Kinderspiel „Ich packe meinen Koffer und nehme mit…“ – diesmal hat die Familie offenbar sehr ausgiebig gespielt. Zum Glück gibt’s ja praktische Lösungen wie Dachboxen, Heckboxen oder kleine Anhänger, die für ordentlich zusätzlichen Stauraum sorgen. Aber Achtung: Wer sein Fahrzeug erweitert, sollte ein paar wichtige Dinge beachten – damit die Reise nicht nur komfortabel, sondern auch sicher und regelkonform verläuft.
Die Dachbox – beliebt, aber nicht ganz ohne
Die Dachbox ist der Klassiker unter den Stauraumerweiterungen. Mit 300 bis 600 Litern Volumen passen jede Menge Kleidung, Spielzeug oder Campingzubehör hinein. Doch allzu schweres Gepäck gehört nicht aufs Dach, denn eine randvolle Box verändert den Schwerpunkt des Autos und wirkt sich auf das Fahrverhalten aus. Während der Fahrt gilt die zulässige Dachlast – sie ist in der Betriebsanleitung zu finden, nicht im Fahrzeugschein! Meist liegt diese inklusive Trägersystem und Eigengewicht zwischen 50 und 100 Kilogramm. Ebenfalls gut zu wissen: Eine Dachbox erhöht den Luftwiderstand – was je nach Fahrweise den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 Prozent steigen lässt.

Die Heckbox – praktisch und rückenschonend
Eine Heckbox wird auf der Anhängerkupplung montiert und ist eine gute Alternative zur Dachbox – vor allem, weil man sich das Hantieren über Kopf spart. Sie fasst meist 200 bis 400 Liter, was für Urlaubsgepäck oft völlig ausreicht. Wichtig ist hier die sogenannte Stützlast – also das Gewicht, das auf die Kupplung wirken darf. Die steht im Fahrzeugschein (Punkt 13) oder direkt am Kugelkopf. Oft sind es zwischen 50 und 75 Kilogramm. Klingt nach viel – ist es aber nicht unbedingt: Wenn Träger und Box schon 30 Kilogramm wiegen, bleiben bei 50 Kilogramm Stützlast eben nur noch 20 Kilogramm fürs Gepäck. Also: Gewicht vorher checken und nicht überladen. Un beachten, dass sich auch hier das Fahrverhalten verändert.

Der Anhänger – wenn’s richtig viel wird
Für große Gepäckmengen oder sperrige Dinge ist ein Anhänger oft die beste Lösung. Mit Planenaufbau wird alles wettergeschützt. Das zulässige Gewicht steht in den Fahrzeugpapieren. Wichtig ist auch hier die Stützlast, also das Gewicht, das auf die Kupplung drückt. Deshalb: Gepäck im Anhänger gut verteilen, damit nichts aus dem Gleichgewicht gerät. Wer ins Ausland fährt (zum Beispiel die Niederlande, Österreich oder die Schweiz), muss den Anhänger mit einer zusätzlichen Sicherung wie einem Seil oder einer Kette mit dem Auto verbinden – sonst drohen saftige Bußgelder. Übrigens: Auch auf der Autobahn gilt mit Anhänger meist Tempo 80.

Ladung immer richtig sichern!
Egal, wo das Gepäck untergebracht ist – gut verzurrt muss es sein! Denn bei einer Vollbremsung sollte die Ladung keinesfalls durch die Gegend fliegen. Das schützt nicht nur den Inhalt von Koffer und Co., sondern vor allem die Insassen. Eine korrekte Ladungssicherung ist ein echter Sicherheitsfaktor!