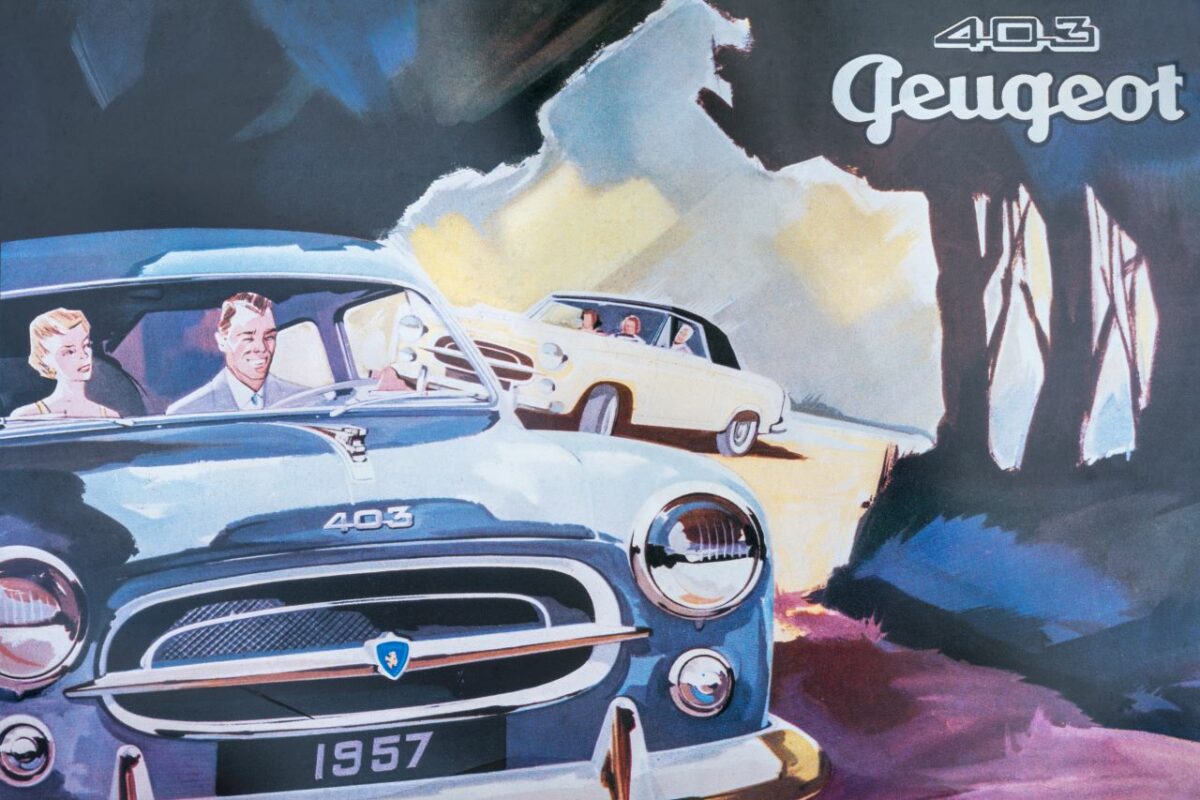- 03. Juni 2024
- Tradition & Innovation
- Reiner Schloz
Italieneischer Keil erobert die USA
Aus dem Archiv von GTÜ Classic: der Fiat X1/9

Besonders schnell war er nicht, aber in den Kurven sehr agil. Seine Form strotzte vor Extravaganz und bot jede Menge Frischluftvergnügen. Der Fiat X1/9 erfüllte seine Rolle als ein kleiner Sportwagen souverän. Bei diesem Spitzenteam konnte auch eigentlich gar nichts schiefgehen. Das Zusammenspiel von Bertone und Fiat war für die Italiener so erfolgsversprechend wie das ihrer Fußballhelden Gianni Rivera und Sandro Mazzola. Schon mit dem Fiat 850 Spyder hatte das Duo aus dem Karosserie-Spezialisten Bertone und der Autofabrik von Fiat die Herzen der US-Amerikaner erobert. Doch als Ende der 60er Jahre aus Übersee knallharte Sicherheitsbedingungen für Cabrios drohten, war die Zeit des 850 vorbei. Bertone-Chefdesigner Marcello Gandini aber hatte vorausgedacht.
Plötzlich steht da eine Flunder
1969 präsentierte Bertone auf dem Turiner Autosalon mit dem „Concept Car Autobianchi Runabout“ eine keilförmige flache Flunder mit Klappscheinwerfern, feststehendem Überrollbügel in Targa-Manier und der Aussicht auf ein aufregendes Frischluftvergnügen. Wie von Bertone erwartet, griff Fiat zu und formte das futuristische Outfit leicht zur Serienreife um. Bertone hatte von Anfang an die Fiat 128-Baureihe als technische Basis im Auge. Allerdings musste die Frontantriebs-Einheit zum Heckantrieb umgewandelt werden und der Motor rutschte in die Mitte. Fertig war X1/9. Im Oktober 1972 begann die Produktion.
Spaßmobil mit eigenem Willen
Ein Auto zum Verlieben, ein Spaßmobil mit Eigenheiten. Das fing bei den Maßen an. Mit nicht mal vier Metern Länge und einer Höhe von unter 1,20 Meter wurde er gern als „Baby-Ferrari“ bezeichnet. Sein Targa-Bügel bestand aus mindestens vier Lagen Stahlblech, die jedem drohenden Überschlag standhielten. Wie es sich für ein Mittelmotor-Modell gehört, hatte der X1/9 zwei Stauräume, einen vorn, wo auch das Kunststoffdach untergebracht werden musste, und hinten. Tank und Reserverad teilen sich mit dem Aggregat den Motorraum. Den Antriebsstrang erreichte man nur über eine etwas zu kleine Reparaturklappe. Um ans Reserverad zu kommen, musste der Beifahrersitz umgeklappt werden. Richtig praktisch war das nicht.
Mehr als 86 PS waren nicht drin
Aber das sind vernachlässigbare Unbequemlichkeiten, setzt man sie in Relation zum Fahrspaß. Besonders in den Kurven zeigte der X1/9 seine Leistungsfähigkeit, schließlich sorgten Heckantrieb und Mittelmotor für eine nahezu optimale Gewichtsverteilung. Der Motor stammte vom Fiat 128, ein solider Vierzylinder-Reihenmotor mit oberliegender Nockenwelle und zwei Ventilen pro Zylinder. Er hatte 1,3 Liter Hubraum, die 75 PS (55 kW) mussten mit einem Vierganggetriebe manuell dirigiert werden. Wirklich üppig war das nicht, weshalb Fiat ab 1978 den 1,5-Liter Benziner mit 86 PS (63 kW) und Fünfgang-Schaltgetriebe nachlegte. Der Grundpreis in Deutschland betrug damals 11.285 Mark.
Zum Schluss übernimmt Bertone alles
Etwa 70 Prozent der gesamten X1/9-Produktion landeten in den USA. Fiat musste also frühzeitig mit emissions- und leistungsschwächeren Motoren für den US-Markt arbeiten. Da jedoch der gesamte Fiat-Absatz in Übersee zurückging, zog sich das Unternehmen zurück und Bertone, bis dahin nur für die Fertigung der Karosserie zuständig, übernahm den X1/9 komplett. Von 1982 an hieß der Wagen Bertone X1/9. Zwei Jahre später kam für die USA der X1/9 mit geregeltem Drei-Wege-Kat auf den Markt, Fiat bot ihn als erster Hersteller in Europa an.
Heute ist er ein Schnäppchen
Erst 1988 und nach rund 166.000 Fahrzeugen stellte auch Bertone die Produktion des X1/9 ein. Verkauft wurde der Wagen in Deutschland aber bis 1990. Es handelte sich um rückgeführte Lagerbestände aus den USA. Wer heute in den Genuss des einst futuristischen und längst zum Oldtimer gereiften Sportwagen kommen will, muss gar nicht so tief in die Tasche greifen. Gut erhaltene Modelle sind zwischen 4000 und 6000 Euro zu haben.