- 29. Januar 2026
- Sicherheit & Praxis
- Peter Thomas
Von Abstand, Rettungsgasse und Richtgeschwindigkeit: Was Fahranfänger über die Autobahn wissen sollten
Der Führerschein ist geschafft, inklusive der vorgeschriebenen vier Autobahnfahrten in der Fahrschule. Doch viele Fahranfänger haben reichlich Respekt vor der Autobahn: hohe Geschwindigkeit, hohes Verkehrsaufkommen, andere Abläufe als im sonstigen Straßennetz. Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung beruhigt: Wer sich auskennt und einige Tipps beachtet, kommt auf den Bundesautobahnen bestens voran. Diese gehören zu den sichersten Straßen im Verkehrsnetz.
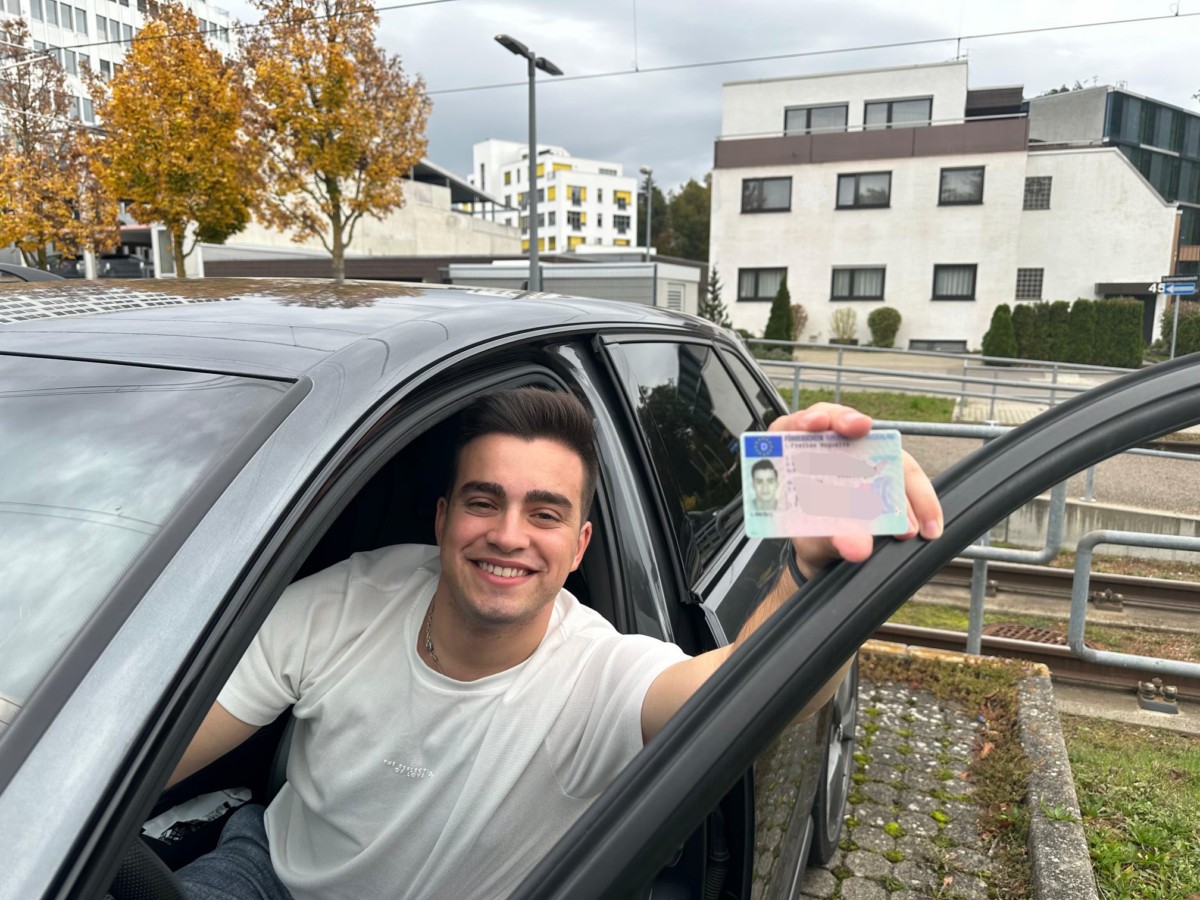
Kein Tempolimit?
Richtig, Deutschland ist bekannt dafür, dass es keine grundsätzliche Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn gibt. Aber daraus folgt kein „Vollgas“. Denn auf vielen Autobahnabschnitten gelten Geschwindigkeitsbeschränkungen. Sie sind ausgeschildert – entweder dauerhaft oder zeitweise über dynamische Anzeigen. Vor allem aber gibt es die sogenannte Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Sie steht seit 1978 in einer eigenen Verordnung – und hat Folgen: Wer deutlich schneller fährt und in einen Unfall gerät, bekommt vor Gericht häufig eine Mitschuld zugesprochen, selbst wenn er den Crash nicht ausgelöst hat.
Bloß nicht Drängeln!
Einer der großen Unfalltreiber heißt: zu wenig Abstand. Die entsprechende Faustregel für das sichere Fahren auf der Autobahn ist simpel: „Halber Tacho in Metern“. Wer also 120 km/h fährt, der lässt am besten 60 Meter frei zum vorwegfahrenden Auto. Das klingt viel, ist aber genau der Raum, den man braucht, wenn plötzlich gebremst wird. Ein praktischer Trick: Die Leitpfosten am Rand stehen meist 50 Meter auseinander – daran lässt sich der Abstand gut abschätzen.
Entspannt Einfädeln
Bloß nicht bei der Auffahrt auf die Autobahn den Stresspegel steigen lassen: Der Beschleunigungsstreifen ist dazu da, das eigene Tempo der Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen anzugleichen. Also: zügig beschleunigen, den Verkehr im Spiegel lesen, eine Lücke suchen, blinken – und dann sauber einfädeln. Wichtig: Der durchgehende Verkehr hat Vorfahrt. Wer hineindrängt, produziert Risiken.
Links oder rechts überholen?
Wie hieß es in der Fahrschule? Auf der Autobahn gilt Rechtsfahrgebot. Wer dauerhaft links bleibt, blockiert und provoziert im schlechtesten Fall. Überholt wird allerdings grundsätzlich links. Rechts vorbei ist normalerweise tabu, mit wenigen Ausnahmen: Beim Einfädeln darf man langsamere Fahrzeuge passieren. Und im Stau oder zähfließenden Verkehr ist rechts überholen erlaubt – vorsichtig und mit höchstens 20 km/h Differenz.
Guter Dialog ist wichtig
Spurwechsel ohne Blinker ist so gefährlich wie Fahrradfahren ohne Handzeichen. Auf der Autobahn ist Blinken deshalb nicht nur Pflicht, sondern ein echter Beitrag zur Sicherheit: Drei bis vier Blinkimpulse vor dem Wechsel nach links oder rechts machen das Fahrmanöver für andere berechenbar und verhindert Missverständnisse. Merkhilfe: Wer blinkt, kommuniziert.
Keine Panik bei Panne oder Unfall
Wenn trotzdem mal etwas schiefgeht? Keine Panik bei Panne oder Unfall. Für Beteiligte gilt: Warnblinker an, möglichst auf den Standstreifen fahren, Warnweste überziehen (sie liegt am besten griffbereit in Fahrer- und Beifahrertür) und das Warndreieck zur Absicherung aufstellen. Andere Verkehrsteilnehmer setzen bei Bedarf den Notruf ab und leisten Erste Hilfe.
Rettungsgasse frühzeitig bilden
Ganz entscheidend: Schon bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse bilden – nicht erst, wenn im Rückspiegel das Blaulicht zu sehen ist. Die Rettungsgasse hat eine einfache Logik, die man sich am Beispiel der gespreizten rechten Hand merken kann: Autos auf der ganz linken Spur fahren nach links – wie der Daumen. Fahrzeuge auf allen anderen Spuren ziehen nach rechts – wie die Finger. So entsteht in der Mitte Platz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Wer das beherzigt, spart Minuten. Und die können Leben retten.
Glückwunsch zum 100. Geburtstag
Zum Schluss ein Blick über die Leitplanken: Autobahnen sind besondere Straßen. Sie haben mindestens zwei Spuren je Richtung, keine Kreuzungen auf gleicher Höhe und sind ausschließlich für Fahrzeuge mit mindestens 60 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit freigegeben. Die Idee ist übrigens älter als viele denken: Vor 100 Jahren wurde 1926 der HaFraBa-Verein zum Bau der ersten Autobahn gegründet. 1932 eröffnete das erste Teilstück zwischen Köln und Bonn. Heute umfasst das Netz rund 13.000 Kilometer – inklusive etwa 28.000 Brücken und 550 Tunneln.






